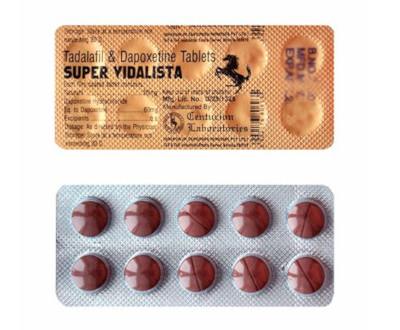Das Hamburger Modell
Das Hamburger Modell: Beschreibung
Galedary & Rethemeier (2013a) beschreiben verschiedene Therapiesettings. Die Standardversion mit ein bis zwei Sitzungen pro Woche, in der Regel von Einzeltherapeuten durchgeführt, die desselben Geschlechts wie die Symptomträger sein sollten, haben eine Dauer von neun Monaten bis zwei Jahren bei ca. 30 – 60 Sitzungen. Die dreiwöchige Kompakttherapie (auch Intensivtherapie oder massierte Therapie genannt) mit sechs täglichen Sitzungen pro Woche wird immer von gemischtgeschlechtlichen Therapeutenteams durchgeführt. In diesem Intensivsetting wurden über viele Jahre Sexualtherapeutinnen und Sexualtherapeuten ausgebildet und auch die Daten einer kürzlich publizierten Evaluationsstudie erhoben (Maß et al., 2014; siehe unten). Schließlich kann die Behandlung auch in Gruppen aus vier bis fünf Paaren erfolgen, welche wiederum von aus einem Mann und einer Frau bestehenden Therapeutenteams geleitet werden. Jede Gruppensitzung dauert 120 – 180 Minuten, bei 25 – 35 Sitzungen in neun bis zwölf Monaten. Der Ablauf der Behandlung ist für die Paare mit wenigen Ausnahmen unabhängig von der Diagnose grundsätzlich immer gleich.
Behandelt wurden ursprünglich (Hauch et al., 1980) Männer mit Erektionsstörungen oder vorzeitigem bzw. ausbleibendem Samenerguss und Frauen mit Erregungs- oder Orgasmusstörungen oder Vaginismus. Später wurde der Indikationsbereich auf alle chronifizierten sexuellen Funktionsstörungen ausgeweitet, insbesondere wurde das mangelnde oder fehlende sexuelle Verlangen einbezogen (vgl. Maß, 2014; siehe unten). Ob die Störung primär oder sekundär ist, wird hinsichtlich der Durchführung der Therapie als unerheblich betrachtet.
Einzelgespräche
Nach Vor- und Indikationsgesprächen, in denen u. a. das geeignete Setting festgelegt wird, finden zunächst explorative Einzelgespräche statt. In diesen werden die vorliegenden Probleme und deren Bedeutung für die Partnerschaft (z. B. Symptome, Kommunikationsverhalten), die sozio-sexuelle Entwicklung (z. B. Kindheit, frühere Beziehungen) sowie die Entwicklung bis zur aktuellen Situation in der aktuellen Partnerschaft erfragt. Die Ergebnisse dieser Einzelgespräche werden bis zur nächsten Paarsitzung, dem Roundtable, ausgewertet. Die Therapeuten formulieren ihre Arbeitshypothese zur Erklärung der Symptome auf der Grundlage der Explorationen. Beim Roundtable soll für das Paar plausibel dargestellt werden,
» . . . daß aufgrund der Lerngeschichte die Funktionsstörung fast zwangsläufig auftreten mußte und möglicherweise sogar noch als geglückte Kompromißbildung anzusehen ist. Mit dieser Erklärung beabsichtigen die Therapeuten, die Beziehung der Patienten zu entlasten, sie aus den Verstrickungen gegenseitiger Vorwürfe zu lösen und den Weg für die gemeinsame Arbeit am Symptom zu ebnen« (Pfäfflin et al., 1980, S. 181).
Paarübungen und Regeln
Im zweiten Abschnitt des Roundtables werden die Instruktionen für die erste Paarübung »Streicheln I«13 gegeben. Es werden außerdem einige Regeln festgelegt. Wie bei Masters und Johnson oder Kaplan wird das Paar gebeten, bis auf weiteres auf Geschlechtsverkehr und genitales Petting zu verzichten (Selbstbefriedigung in Abwesenheit des Partners ist gestattet); diese Regel wird auch kurz »Coitusverbot« genannt. Die Aufforderung Kaplans (1974) an ihre Patienten, während der Übungen egoistisch zu sein, wurde beim Hamburger Modell weiterentwickelt und systematisch als sogenannte »Grundregel« gefasst, die für die gesamte Therapie Gültigkeit hat (Hauch et al., 1980). Sie besteht aus zwei Teilen: Falls das Streicheln unangenehm wird, soll dies dem Partner mitgeteilt und durch geeignete Maßnahmen beendet werden; und die Partner sollen beim Streicheln auf die eigenen Gefühle achten und sich nicht für den anderen verantwortlich fühlen. 2006 wurde diese Grundregel als »Prinzip Selbstverantwortung« neu konzipiert:
»Die erste Grundregel ist die so genannte Egoismusregel. Sie besagt, dass jede/r nur das tun soll, was ihr/ihm gefällt, und es sich zur Aufgabe machen soll, bewusst für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Dafür ist sie/er verantwortlich, und nicht für das Wohlergehen der/des PartnerIn [sic]. Die zweite Grundregel ist die so genannte Vetoregel. Sie verpflichtet die PartnerInnen, ein deutliches verbales Zeichen, also ein »Veto« zu sagen, wenn ihr/ihm etwas unangenehm ist. So übernehmen sie die Verantwortung für die Wahrnehmung und Setzung ihrer eigenen Grenzen. Ein »Veto« ist unbedingt zu respektieren, wozu sich die/der andere wiederum verpflichtet« (Cassel-Bähr, 2013, S. 62).
Mit der Neukonzeption war auch eine Aufwertung des Selbstverantwortungsprinzips verbunden, welches inzwischen als das wesentliche Element des gesamten Therapiekonzepts betrachtet wird (vgl. Hauch & Hill, 2014).
Therapieschritte
Bei Hauch (2013) werden sechs Therapieabschnitte unterschieden, die im Folgenden beschrieben werden.
Streicheln I
Das Paar soll sich bis zur nächsten Sitzung zweimal ca. 60 Minuten Zeit nehmen. Es wird, wie bei Kaplan (1974), zwischen aktiver (streichelnder) und passiver (aufnehmender) Rolle sowie zwischen Bauch- und Rückenlage unterschieden, Brüste und Genitalien sind ausgeschlossen (»Tabuzonen«). Gestartet wird in der Bauchlage, dann folgt die Rückenlage, zuletzt folgt nochmals die Bauchlage, die als dritter Abschnitt hinzugefügt wurde. Anders als bei Kaplan tauschen die Partner die aktive und die passive Rolle in jeder der drei Lagen. Jede Rolle soll für etwa fünf Minuten eingenommen werden. Der aktive Partner soll sich seitlich neben den passiven hocken oder legen, ihn am ganzen Körper streicheln und auf unterschiedliche Weise berühren, der passive Partner soll aufmerksam auf seine Wahrnehmungen und Gefühle achten. Ursprünglich (Arentewicz & Schmidt, 1980) wurde der passive Partner aufgefordert, dem aktiven verbal und nonverbal mitzuteilen, welche Berührung angenehm und welche unangenehm ist, er konnte auch die Hand des aktiven Partners führen. Das wurde im Laufe der Jahre (Hauch, 2013) geändert, nun soll der passive Partner die Berührungen auf sich wirken lassen, ohne selbst einzugreifen, außer durch die Anwendung der Vetoregel.
Ziel der Übung Streicheln I ist, sich im körperlichen Kontakt sicher und entspannt zu fühlen. Sexuelle Erregung ist noch kein Ziel, vielmehr soll die einseitige Ausrichtung auf sexuelles Funktionieren, Coitus und Orgasmus überwunden werden. In der nächsten Sitzung werden die Erfahrungen des Paares mit den Übungen sorgfältig und detailliert exploriert. Nach zwei bis drei Sitzungen in der Phase Streicheln I wird das Selbstverantwortungsprinzip dahingehend erweitert, dass Wünsche geäußert werden dürfen. Der Patient in der passiven Rolle kann konkrete Wünsche darüber äußern, wie und wo er berührt werden möchte. Dabei gilt, dass ein Wunsch kein Befehl ist und der aktive Partner ihn i. S. der Egoismusregel nur dann erfüllen soll, wenn er selbst es möchte.
Ist das Paar in der Lage, die Übung Streicheln I zumindest gelegentlich als angenehm und entspannend zu empfinden und dabei das Selbstverantwortungsprinzip einzuhalten, so wird zum nächsten Abschnitt übergegangen.
Streicheln II
Diese Übung ist mit Streicheln I identisch, außer dass nun – wie beim Sensate Focus II von Kaplan – die Brüste und Genitalien oberflächlich, d. h. ohne besondere Berücksichtigung, einbezogen werden können. Dennoch soll das Paar weiterhin keine sexuelle Erregung, sondern Entspannung herstellen.
Streicheln III (Erkunden des Genitalbereichs)
Ziel ist, die eigenen Genitalien und die des Partners besser kennenzulernen. Die Übung gleicht Streicheln II. Jedoch soll der passive Partner dem aktiven am Ende des mittleren Abschnitts (Rückenlage) zunächst seine Genitalien zeigen und erklären. Dazu nimmt er eine bequeme sitzende Haltung mit gespreizten Beinen ein; der andere Partner sieht und hört zu, darf Fragen stellen, aber noch nichts berühren. Das wird mit vertauschten Rol
Zusätzlich zu dem »Veto« wird im Hamburger Modell der Begriff »Stopp« benutzt, mit dem die Patienten Grenzsetzungen signalisieren sollen, die sich aus dem Setting ergeben (z. B. wenn bei Streicheln I eine Berührung sexuelle Erregung auslöst). In späteren Übungen (mittlerer Abschnitt) werden die Genitalien des auf dem Rücken liegenden Partners auf erkundende, nicht stimulierende Weise berührt und gestreichelt. Ziel ist immer noch, sich während des Streichelns zu entspannen und wohlzufühlen.
Spiel mit der sexuellen Erregung (stimulierendes Streicheln): In diesem Abschnitt soll erstmals gezielt sexuelle Erregung erzeugt werden. Es handelt sich um eine Variante einer von Masters & Johnson (1970) eingeführten Technik. Der Mittelteil der Übung (bisher Streicheln in Rückenlage) wird modifiziert. Der aktive Partner soll nun den passiven stimulieren, wobei wiederum geeignete Stellungen vorgeschlagen werden, wie sie auch von Masters und Johnson bzw. Kaplan verwendet wurden. Wenn die Frau zuerst in der aktiven Rolle ist, kann sich der Mann mit angewinkelten, gespreizten Beinen auf den Rücken legen, die Frau setzt sich zwischen seine Beine. Sie soll nun den Genitalbereich des Mannes stimulieren; dieser soll ihr mitteilen, was ihm gefällt und was nicht, kann dabei auch ihre Hände führen. Nach fünf bis zehn Minuten – ob es zu sexueller Erregung gekommen ist oder nicht – werden die Rollen gewechselt; nun kann sich der Mann so hin setzen, dass er sich mit dem Rücken bequem anlehnen kann, die Frau setzt sich zwischen seine Beine und lehnt sich gegen seinen Brust/seinen Bauch. So kann der Mann die Arme um sie legen, ihren Genitalbereich erreichen und sie dort stimulieren. Wichtig ist ein spielerischer Umgang mit sexueller Erregung. Es soll zunächst noch nicht zum Orgasmus kommen, ggf. gibt der stimulierte Partner ein Zeichen (»Stopp«) und unterbricht die Stimulation, um die Erregung abklingen zu lassen. Das kann zwei-bis viermal wiederholt werden. Nach einigen Übungen können die Partner sich gegenseitig zum Orgasmus bringen.
Einführen des Penis
Der Ablauf ist zunächst wie beim stimulierenden Streicheln. Im Mittelteil der Übung soll sich die Frau in der aktiven Rolle dann über den Mann knien und den erigierten Penis selbst in ihre Vagina einführen, der auf dem Rücken liegende Mann soll es geschehen lassen. Danach, wenn die Frau auf dem Mann hockt, machen beide keine weitere Bewegung. Diese Übung stammt ebenfalls von Masters und Johnson (die manchmal verwendete Bezeichnung »Quiet Vagina« stammt von Hartman & Fithian, 1972, und meint eine andere Übung; siehe Abschnitt 6.2.12). Nach zwei bis drei Minuten soll der Penis wieder ausgeführt werden, sofern er nicht bereits von selbst herausgerutscht ist. Der Vorgang kann ein- bis zweimal wiederholt werden. Es ist gestattet, dass die Partner sich danach manuell oder oral zum Orgasmus bringen; das Paar kann die Erregung aber auch einfach abklingen lassen und zum letzten Drittel der Übung übergehen. Diese Phase der Therapie ist oft mit besonderen Ängsten verbunden. Daher ist wichtig, dass das Paar den Vorgang unspektakulär und als einfache Fortführung der Streichelübung erlebt. Bei der Vaginismusbehandlung verwenden die Patientin bzw. ihr Partner in dieser Therapiephase Hegarstäbe; dies wurde von der Patientin zuvor allein geübt.
Koitus mit erkundenden und stimulierenden Bewegungen. In diesem letzten Therapieabschnitt sollen die Partner Erfahrungen mit verschiedenen Arten von Beckenbewegungen beim Coitus machen. Der Ablauf gleicht der vorherigen Übung, nur soll die Frau nun mit vorsichtigen Beckenbewegungen beginnen und spielerisch verschiedene Arten (auf und ab, kreisend etc.) erproben. Später kann der Mann ebenfalls mit Beckenbewegungen beginnen. Dies soll ohne Erfolgsdruck geschehen, es sollen spielerisch die eigenen Vorlieben und Abneigungen erkundet werden. Der Orgasmus soll während der Beckenbewegungen zunächst noch vermieden bzw. durch anderweitige Stimulation herbeigeführt werden, erst wenn das Paar einige Sicherheit gewonnen hat, kann der Coitus bis zum Orgasmus führen. Dann wird das Therapieende eingeleitet.
Einzelübungen
Zu dem Grundprogramm der Paarübungen kommen ergänzende Übungen, die von jedem der Partner allein gemacht werden und der körperlichen Selbsterfahrung dienen. Diese Kombination von Sensate-Focus-Paarübungen nach Masters und Johnson mit einem Programm aus Einzelübungen geht ursprünglich auf Lobitz & LoPiccolo (1972) bzw. LoPiccolo & Lobitz (1972) zurück. Die Einzelübungen haben – wie auch das Selbstverantwortungsprinzip – im Laufe der Jahre beim Hamburger Modell an Bedeutung gewonnen.
Mit den Einzelübungen soll begonnen werden, wenn das Paar die Prinzipien der Paarübung Streicheln I in den Grundzügen verstanden hat. Beide Partner – nicht nur der Symptomträger – sollen dann zusätzlich zu den Paarübungen auch die Einzelübungen zwischen den Sitzungen zweimal durchführen. Dabei sollten die Einzelübungen die weiteren Schritte in den Paarübungen thematisch gewissermaßen vorbereiten (z. B. Spiel mit der Erregung erst in der Einzel-, dann in der Paarübung). Ziel der Einzelübungen ist, den eigenen Körper einschließlich des Genitalbereichs und seine Reaktionen besser kennen zu lernen. Auch diese Übungen sollen in Ruhe und ohne äußere Störungen gemacht werden, die Patienten sollen sich dafür ca. ein halbe Stunde Zeit nehmen, das Selbstverantwortungsprinzip gilt auch hier. Folgende Einzelübungen werden in dieser Reihenfolge vorgegeben:
- Betrachten des unbekleideten Körpers in einem großen Spiegel (stehend);
- Berühren des gesamten Körpers (unbekleidet, liegend);
- Betrachten und erkundende Berührung des Genitalbereichs;
- Spiel mit der Erregung (erst ohne, dann mit Orgasmus).
Frauen mit Vaginismus und Dyspareunie benutzen die Hegarstäbe zunächst in den Einzelübungen, später – bei wachsender Sicherheit – werden sie auch in den Paarübungen verwendet. Außerdem werden die Frauen mit Vaginismus in die sogenannten Kegel-Übungen eingeführt. Dabei handelt es sich um Kontraktionsübungen für die Beckenbodenmuskulatur, die ursprünglich Ende der 1940er Jahre von dem US-amerikanischen Urologen Arnold Kegel zur Behandlung von Patientinnen mit Harninkontinenz entwickelt wurden (z. B. Kegel, 1948). Es wurde beobachtet, dass die Übungen auch zu verbesserter Empfindungsfähigkeit im Genitalbereich und zu intensiveren Orgasmen führen. Bei männlichen Probanden wurden in den 1950er Jahren positive Effekte in Hinblick auf vorzeitige Ejakulationen beschrieben (Kegel, 1952).
Die Erfahrungen der Patienten in den Einzelübungen werden stets in den Paarsitzungen exploriert. Oftmals stellen die Einzelübungen für die Patienten Konfrontationen dar (z. B. Scham, Ängste, Körperfeindlichkeit), die nicht weniger fordernd sind als die Erfahrungen in den Paarübungen.
Die Therapie endet mit einem bilanzierenden Abschlussgespräch; es sollten in größeren Abstanden Katamnesegespräche vereinbart werden.
Nach unseren eigenen Erfahrungen mit dem Hamburger Modell (vgl. Bauer & Maß, 2014) kommt es in der Regel im Laufe der Therapie zu einer Generalisierung, d. h. zu einer Anwendung des Erlernten auf andere Lebensbereiche innerhalb und auch außerhalb der Paarbeziehung.
Diskussion
Verstärkte Strukturierung. Im Vergleich mit seinen Vorläufern (Masters und Johnson, Kaplan) ist der Ablauf des Therapieprogramms beim Hamburger Modell wesentlich stärker vorgegeben und verläuft – unabhängig von den Eingangsdiagnosen – bei allen Paaren weitgehend gleich. Bis auf die Verwendung von Hegarstäben und die Kegel-Übungen bei Vaginismus gibt es keine diagnosespezifischen Interventionen. Die Strukturierung des Hamburger Modells hat im Laufe der Jahre offenbar noch zugenommen. Beispielsweise wurde ursprünglich im Einzelfall entschieden, wie intensiv und wie weit die Einzelübungen Verwendung fanden (vgl. Arentewicz & Schmidt, 1980); bei den männlichen Patienten, zumal, wenn deren Partnerin das Symptom trug, wurden sie häufig gar nicht eingesetzt, Erfahrungen mit Masturbation galten oft als hinreichend. Inzwischen wird der Bedarf an individueller körperlicher Selbsterfahrung bei Männern völlig anders eingeschätzt, die Einzelübungen sind für beide Partner obligatorischer Bestandteil der Therapie (Kleber et al., 2013). Diese strikte Regelung könnte allerdings in manchen Fällen dazu führen, dass ein Patient oder eine Patientin etwas übt, was er oder sie bereits beherrscht, so dass die Übungen sinnlos wären.
Voraussetzungen für die Ausbildung zum Sexualtherapeuten
Das Hamburger Modell wurde von seinen Vertretern nicht als bloße Sexualtherapie, sondern im Sinne von Kaplan (1974) als Psychotherapie für Paare konzipiert; der Anspruch, vollwertige Psychotherapie zu sein, wurde im Laufe der Zeit noch unterstrichen (Hauch & Hill, 2014). Dies bringt für die Therapeutinnen und Therapeuten hohe Anforderungen an ihre fachliche Qualifikation mit sich. Zur Weiterbildung wird in der Regel nur zugelassen, wer Erfahrungen in einer anerkannten Therapieform (Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Gesprächstherapie etc.) hat, wobei zu Beginn diese Qualifikation nicht an formale Kriterien geknüpft war. Inzwischen wird eine abgeschlossene Ausbildung verlangt.
Das Hamburger Modell und gemindertes sexuelles Verlangen
Das Phänomen des mangelnden sexuellen Verlangens fand erst nach den Studien von Masters & Johnson (1970) und Arentewicz & Schmidt (1980) breitere Beachtung (vgl. Kapitel 4). Heute ist mangelndes Verlangen bei Frauen die am häufigsten diagnostizierte sexuelle Störung. In den Studien, mit denen das Hamburger Modell entwickelt wurde, galt mangelndes Verlangen als Sonderform der sexuellen Aversion und wurde entweder als Reaktion auf eine sexuelle Funktionsstörung oder als zusätzliche Folgeerscheinung der Faktoren betrachtet, welche die sexuelle Funktionsstörung verursachen (Arentewicz & Schmidt, 1980). Konsequenterweise wurde das somit als Sekundärphänomen betrachtete fehlende Begehren nicht untersucht. Dennoch fand sich in der zweiten Auflage (Arentewicz & Schmidt, 1986) unter den Indikationen für das Hamburger Modell nun die »sexuelle Lustlosigkeit ohne Funktionsstörung« (gemeint ist das mangelnde oder fehlende Verlangen) als neue diagnostische Kategorie, ohne dass dafür eine neue Stichprobe untersucht wurde.
In der dritten Auflage (Arentewicz & Schmidt, 1993) wurde das mangelnde Verlangen nachträglich den Erregungs- bzw. Orgasmusstörungen zuge ordnet. Auch bei Hauch (2005) wird mangelndes Verlangen zu den Indikationen des Hamburger Modells gezählt, ohne dass es empirische Evidenz dafür gibt (siehe die Analyse bei Maß, 2014). Clement (2001) und Schmidt (2005), immerhin zwei der Entwickler des Hamburger Modells, haben später Skepsis an der Eignung des Konzepts zur Behandlung des mangelnden sexuellen Verlangens geäußert und sich damit der pessimistischen Einschätzung von Kaplan angeschlossen (siehe Kap. 2.2). Eine aktuelle Studie (Maß et al., 2014; Maß & Briken, 2016) bestätigte diese Skepsis: Zumindest die dreiwöchige Intensivtherapie scheint bei Frauen mit mangelndem Begehren nicht so wirksam zu sein wie bei Männern und Frauen mit klassischen sexuellen Funktionsstörungen.
Feministisch-ideologischer Einfluss
Die Hintergründe der Wandlung des Hamburger Modells über die Jahrzehnte werden bei Hauch & Hill (2014) dargestellt:
»Wichtig war die Phase in den 1980er Jahren, als die Thematisierung sexueller Gewalt in den Geschlechterbeziehungen auch unsere Diskurse erreichte [. . .] auch geprägt durch Erfahrungen in der Arbeit mit Männern, die wegen sexueller Gewalthandlungen auffällig geworden waren« (ebd., S. 13 f.).
In den 1980er Jahren gab es in Deutschland eine starke Frauenrechtsbewegung, die z. B. in der neugegründeten Partei der Grünen auch an politischem Einfluss gewann und wesentlichen Einfluss auf die Verbesserung der gesellschaftlichen Rolle und die Stärkung der Rechte von Frauen hatte (siehe hierzu auch Kapitel 4). Dass die feministische Bewegung auch zu notwendigen Veränderungen psychotherapeutischer Konzepte führte, ist aus unserer Sicht richtig und wichtig. Beim Hamburger Modell hat sich dabei allerdings nach Ansicht einiger Experten eine implizite Tendenz eingeschlichen, Frauen als potentielle Opfer übergriffiger Männer zu betrachten, vor denen sie beschützt werden müssen. Hierfür lassen sich Hinweise finden.15 Gunter Schmidt bescheinigte schon 1994 dem Hamburger Modell eine »gnadenlose Sensibilität für Übergriffigkeit«. Clement (2001, 2004)
Bei Hauch (2013) wird ohne Begründung empfohlen, dass ein Mann allein keine Vaginismusbehandlung durchführt, selbst wenn er ein qualifizierter Sexualtherapeut ist (ebd., S. 156), während es keine Bedenken gibt, Erektions- oder Ejakulationsstörungen allein durch eine Sexualtherapeutin behandeln zu lassen; bei der Instruktion zum »Spielen mit sexueller Erregung« wird ausdrücklich auf die Veto-Regel verwiesen, wenn die Frau sich vom Mann stimulieren lässt, aber nicht im umgekehrten Fall beklagte die Übermacht des »Nein« gegenüber dem »Ja« zur Sexualität, die sich in der Vetoregel manifestiere; Schmidt (2005) kritisierte die aus seiner Sicht gouvernantenhafte Form, in der das Hamburger Modell inzwischen angewendet werde; er wies darauf hin, dass die Vetoregel de jure für beide Partner gelte, de facto aber vorrangig auf den Mann ziele, und distanziert sich insbesondere von dem Begriff »Veto«, den er selbst nie verwendet habe und mit »kaltem Krieg und finsteren Großmachtdiplomaten« verbindet. Tatsächlich mutet dieser lateinische Ausdruck, der »ich verbiete« bedeutet, als Teil eines Therapiekonzepts merkwürdig an: Dem Partner etwas zu »verbieten« ist etwas anderes als gut für seine eigenen Grenzen zu sorgen.
Problematische Aspekte des Selbstverantwortungsprinzips
Ein grundsätzliches theoretisches Problem mit der Egoismusregel in der Form, wie sie heute beim Hamburger Modell formuliert wird (s. o.), ergibt sich daraus, dass sie nur funktioniert, wenn sie nicht buchstäblich verstanden bzw. konsequent angewendet wird. Die Idee der Egoismusregel zielt auf die stärkere Übernahme von Eigenverantwortung, was bei den meisten sexuell gestörten Paaren auch dringend notwendig ist; es wird jedoch implizit vorausgesetzt, dass dabei die Verantwortung für das Befinden des Partners nicht völlig aufgegeben wird, denn dies würde zu Dissozialität führen. Zwangsläufig wird daher oft bei der erstmaligen Erläuterung der Egoismusregel hinzugefügt, dass mit Egoismus hier nicht der »böse« Egoismus im Sinne von Rücksichtslosigkeit, Selbstsucht etc. gemeint ist. Andernfalls wäre es nämlich regelkonform, wenn einer der Partner z. B. bewusst in Kauf nimmt, dass dem anderen um der eigenen Bequemlichkeit willen Schmerzen zugefügt werden, z. B. durch Abstützen auf dem Gesicht des Partners.
Wohlgemerkt: Das kommt praktisch nicht vor, und kein Sexualtherapeut würde es (nach dem Motto: Der andere kann ja »Veto« sagen!) durchgehen lassen, aber besser wäre es, die Regel gleich so zu formulieren, dass sie konsistent und aus sich selbst heraus verständlich ist. Widersprüchlich ist beim Hamburger Modell ferner das Verhältnis zwischen dem Selbstverantwortungsprinzip und der ebenfalls angestrebten Verbesserung der Kommunikation zwischen den Partnern. Eine strikte Auslegung des Prinzips (z. B. »Kümmern Sie sich immer nur um ihr eigenes Wohlbefinden, beachten Sie dabei nur die Vetos des Partners«) steht einem Austausch über jeweilige Vorlieben und Aversionen im Wege, die Partner können das zunächst nur sehr begrenzt aus den »Vetos« erschließen. Natürlich werden die Paare beim Hamburger Modell in späteren Therapiephasen aufgefordert, miteinander zu kommunizieren, aber genau genommen müsste das Prinzip Selbstverantwortung dazu teilweise wieder aufgehoben werden; jedoch soll es ohne Abstriche von Anfang bis Ende einer Therapie gelten.
Eine andere Schwierigkeit kann sich aus dem Selbstverantwortungsprinzip ergeben, weil die Patienten damit die Aufgabe erhalten, bewusst für das eigene Wohlbefinden zu sorgen. Selbstverständlich ist den Vertreterinnen und Vertretern des Hamburger Modells bewusst, dass bei den Paarübungen keineswegs nur angenehme Reaktionen auftreten und dass auch unangenehme Erfahrungen für den therapeutischen Prozess nützlich und hilfreich sein können. Dennoch wird bei den Instruktionen (Hauch et al., 2013) von Anfang an hervorgehoben, dass das eigentliche Ziel ist, sich in den Übungen wohl zu fühlen. Hinzu kommt, dass die Verwendung des Begriffs »Streicheln« als Übersetzung von Sensate Focus unweigerlich Assoziationen zu »Wohlbefinden«, »Zuneigung« etc. auslöst.
Dies alles kann zu einem subtilen Druck führen, sich in den Übungen wohl fühlen zu müssen; das gilt insbesondere für Frauen mit mangelndem sexuellen Verlangen, die ohnehin unter dem permanenten Druck stehen, auf eine bestimmte Weise fühlen zu sollen. Die Situation wäre mit einer Aufforderung an einen depressiven Patienten vergleichbar, Freude zu empfinden. Dieses Problem wurde bereits oben in Abschnitt 2.1.3 thematisiert (Response Anxiety; vgl. Apfelbaum, 1988; Weiner & Avery-Clark, 2014). Eine ausführliche Diskussion des Selbstverantwortungsprinzips findet sich bei Maß (2016).
Wissenschaftliche Evaluation
Wie bereits oben erwähnt, wurde das Hamburger Modell der Sexualtherapie im Rahmen eines Forschungsvorhabens entwickelt, so dass die systematische wissenschaftliche Begleitung von Anfang an gewährleistet war. In die Hauptstudie gingen die Daten von 202 Paarbehandlungen aus den Jahren 1973 – 1977 ein: 108 Paare mit Orgasmusstörung der Frau, 27 Paare mit Vaginismus, 57 Paare mit Erektionsstörung und 16 Paare mit Ejaculatio praecox (bei 21 Paaren wiesen beide Partner eine sexuelle Funktionsstörung auf). Die Ergebnisse wurden größtenteils von Arentewicz & Schmidt (1980) beschrieben, in der überarbeiteten Auflage des Buches (Arentewicz & Schmidt, 1986) kamen noch einige katamnestische Ergebnisse hinzu. 99 Paare konnten 30 – 54 Monate (Mittelwert 39 Monate) nach Therapieabschluss nachuntersucht werden.
Im Vergleich zum Zustand vor Therapiebeginn hielten 80 % dieser Paare ihre sexuellen Schwierigkeiten für geringer, 75 % ihre Partnerschaft für besser und 60 % ihre sexuelle Befriedigung für größer. Hinsichtlich einer Einschätzung des langfristigen Therapieerfolgs fassen die Autoren zusammen: »60 % aller Paare werden eine dauerhafte Besserung – mindestens 3 Jahre lang – ihrer Symptome erfahren; 15 % werden in anderen Beziehungen leben und dort in der Regel keine oder weniger sexuelle Probleme haben; 25 % werden weiterhin in der gleichen Partnerschaft mit den gleichen Problemen leben« (Clement & Schmidt, 1986, S. 80). Dies entspricht einer langfristigen Erfolgsquote von 75 %. Dabei wurden nur wenige Unterschiede zwischen den Diagnosegruppen berichtet, und auch diese waren zumeist gering.
In einer weiteren, neueren Studie (Maß et al., 2014; Maß & Briken, 2016) wurden 91 Paarbehandlungen ausgewertet, die 1995 – 2011 am heutigen Institut für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf als Intensivtherapien durchgeführt worden sind. Bei den männlichen Patienten wurden überwiegend Erektionsstörungen oder Ecaculatio praecox diagnostiziert, bei den Patientinnen überwiegend mangelndes sexuelles Verlangen oder Vaginismus. Wiederum wurden Katamneseuntersuchungen ca. eineinhalb Jahre nach Behandlungsende durchgeführt, bei denen 50 Paare erreicht werden konnten.
Aus Therapeutensicht lag zu diesem Zeitpunkt eine Verbesserung der Beziehungsqualität bei 71 %, eine Verbesserung der sexuellen Zufriedenheit bei 73 % vor; die Selbstbeurteilungen der Paare lagen jedoch niedriger (Beziehungsqualität: 66 %, sexuelle Zufriedenheit 58 %). Diesmal gab es auch Unterschiede zwischen den Diagnosegruppen: Die hier erstmals untersuchten Frauen mit der Diagnose eines mangelnden sexuellen Verlangens (MSV) zeigten sich bei der Katamnese sexuell weniger zufrieden als Frauen mit Vaginismus (VAG). Der Wunsch nach einem Coitus war in der MSV-Gruppe bei der Katamnese geringer als in der VAG-Gruppe, er war in der MSV-Gruppe sogar niedriger als vor Beginn der Therapie; auch die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs war in der VAG-Gruppe angestiegen, während der in der MSV-Gruppe unverändert war.
Da bislang, wie oben beschrieben wurde, die Ansicht vorherrschte, das Hamburger Modell sei bei mangelndem Verlangen genau so wirksam wie bei den klassischen Funktionsstörungen, hat die Diskussion über diese Ergebnisse erst begonnen. Eine mögliche Erklärung ergibt sich aus dem oben erwähnten Druck, der sich aus der impliziten Forderung ergeben kann, sich in den Übungen wohl zu fühlen, und der besonders für Frauen mit mangelndem Verlangen spürbar wäre. Eine weitere (Teil-)Ursache könnte darin liegen, dass die beim Hamburger Modell obligatorische Verhütung mit hormonellen Kontrazeptiva durchgeführt werden kann; diese Mittel stehen im Verdacht, sexuelle Funktionen zu dämpfen (Davis & Castaño, 2004; Wallwiener et al., 2010). Falls sich diese Hypothese bestätigen lässt, sollten Frauen mit mangelndem sexuellen Verlangen auf andere Verhütungsmethoden zurückgreifen.
Auch wenn die zitierten Evaluationsstudien methodische Mängel aufweisen, muss hervorgehoben werden, dass das Hamburger Modell derzeit das bestvalidierte sexualtherapeutische Konzept in Deutschland ist.
Home »