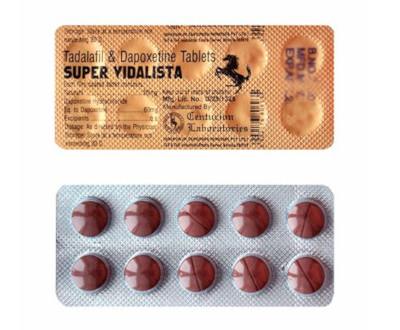Systemische Sexualtherapie
Systemische Sexualtherapie
Spiel-Interventionen
Zu den Spiel-Interventionen gehören Symptomverschreibungen (z. B. »richtig schlechten Sex machen«), Als-ob-Aufgaben (»Tun Sie heute Abend so, als ob Sie an Sex gar nicht interessiert sind.«), Asymmetrie-betonende Aufgaben (für den Partner »Liebesdiener« sein), Verfremdungen und Rollenspiele sowie die Aufgabe »der kleinste vorstellbare Übergriff und die kleinste mögliche Hingabe«. Die Aufgaben sollen zwischen den Sitzungen erledigt werden. Gemeint ist die weitestgehende, allein dem eigenen sexuellen Interesse dienende Handlung, die sich jemand gerade noch herauszunehmen gestattet bzw. die größte Hingabe, die jemand für sich gerade noch akzeptieren kann.
Systemischen Fragetechniken
Wichtig sind die bekannten systemischen Fragetechniken, die auch in der Systemischen Sexualtherapie eingesetzt werden. Dazu zählen Verflüssigungsfragen zum Aufbrechen verhärteter Interaktionsmuster (Beispiel: Die Frau wirft ihrem Partner vor, er interessiere sich nicht für sie; der Therapeut kann sie dann fragen, wann der Partner zuletzt Interesse gezeigt hat), zirkuläre Fragen, bei denen der Befragte die Sichtweise seines Partners beschreiben soll, die Wunderfrage, welche den versteckten Vorteil des Symptoms (auch und gerade für den symptomfreien Partner) aufdecken soll, Fragen nach Ressourcen und Verschlimmerungsfragen mit derselben Intention wie Symptomverschreibungen (»Was müssten sie tun, damit ihr Partner sich noch weniger für Sie interessiert?«). Auch ein Symptom wie die Ejaculatio praecox kann als Ressource betrachtet werden, indem man es als Kompetenz für die Regelung von Nähe und Distanz interpretiert und ihm damit eine positive Bedeutung zuweist (Clement, 2004, S. 55). Ähnliche Konzepte findet man auch der Verhaltenstherapie (Funktionalität eines Symptoms) und in der Psychoanalyse (sekundärer Krankheitsgewinn); ein Problem wird in Ermangelung besserer Alternativen auf eine Weise gelöst, die kurzfristig Entlastung bringt, langfristig aber so nachteilig ist, dass sie ihrerseits Leiden hervorruft.
Die Frage nach den Folgen des Status quo soll das Paar mit den Konsequenzen konfrontieren, die es hätte, wenn sich trotz der Therapie nichts an der Sexualität ändern würde. Es geht dabei weniger um das Verhalten als um die Bedeutung, welche das Paar seiner Sexualität gibt – es geht um die Basis der Partnerschaft. Die Frage ist bedrohlich, weil sie die Perspektive auf eine Reihe negativer Möglichkeiten eröffnet, die oft mit der Hoffnung auf den Therapieerfolg ausgeblendet werden. Der Blick auf die Konsequenzen (z. B. Trennung) kann die Ernsthaftigkeit im therapeutischen Prozess erhöhen.
Ideale Sexuelle Szenarios (ISS)
Eine zentrale Bedeutung hat bei Clement (2004) die Übung des »Idealen Sexuellen Szenarios« (ISS). Es handelt sich bei dieser intensiven, konfrontativen Technik um eine »Ernst-Intervention«, die für die Patienten bedrohlich sein kann und vom Therapeuten Haltefähigkeit und Angsttoleranz erfordert. Das Paar soll sich ausdrücklich entscheiden, ob es die Aufgabe annimmt oder nicht. Ziel der Intervention ist, über die Thematisierung der sexuellen Wünsche und Abneigungen, der ungelebten Phantasien und gelebten Erfahrungen, der Vorlieben und Orientierungen einer Person ihre sexuelle Identität zu zeigen. Diesbezügliche anamnestische Fragen führen oft zu kargen, unergiebigen Antworten, weil den Patienten ihr sexuelles Profil selbst oft nur teilweise bekannt ist oder Rücksichtnahme und Selbstzensur eine offene Antwort verhindern.
Die Instruktion zum ISS sieht vor, dass jeder der beiden Partner bis zur nächsten Sitzung für sich das Szenario einer sexuellen Handlung entwirft, welches in idealer Weise allein den eigenen Wünschen und Vorlieben entspricht, ohne Rücksicht auf den Partner. Diese Szenarien teilen sich die beiden zunächst nicht mit, sondern schreiben sie auf und bringen sie zur nächsten Sitzung in verschlossenen Umschlägen mit. Dabei muss von Anfang an klar gemacht werden, dass jeder Partner selbst entscheidet, ob der Umschlag geöffnet wird. Es darf vom Therapeuten keineswegs Druck ausgeübt werden, das Szenario mitzuteilen. Entscheidend für die Wirkung dieser Intervention sei nicht, welches Szenario aufgeschrieben wurde und auch nicht, ob es offengelegt wird oder nicht, sondern wie im Verlauf der Therapie darüber verhandelt wird.
Das Paar wird einer Spannung ausgesetzt, die mit dem Differenzierungsaspekt dieser Technik zusammenhängt; schließlich enthält das ISS mit gewisser Wahrscheinlichkeit Aspekte der Sexualität, die bislang nicht kommuniziert wurden. Das ISS könne als Anstoß für Differenzierungsprozesse in einer Partnerschaft dienen, auch ohne dass es explizit wird. Das ISS ist gewissermaßen eine therapeutische Anwendung der Theorie des sexuellen Skripts (Gagnon & Simon, 1973; vgl. auch Money, 1986). Rosen & Leiblum (1988) unterscheiden zwischen dem performativen Skript eines Paares, also dessen tatsächlich gelebter Sexualität, und den häufig nicht kommunizierten idealen Skripten beider Partner. Das ideale Skript entspricht dem ISS. Das performative Skript kann den idealen Skripten gleichen oder davon abweichen. Unterschiede der individuellen idealen Skripte beider Partner sind nicht per se nachteilig, sie können der partnerschaftlichen Sexualität sogar mehr Würze geben; aber wenn die Differenzen unvereinbar sind, können daraus Probleme entstehen:
» . . . wir haben beobachtet, dass die sexuellen Skripte von Personen mit Appetenzstörungen dazu tendieren, entweder zu eng oder zu weit gefasst zu sein, wodurch entweder zu viele oder zu wenige sexuelle Hinweisreize gegeben sind. Somit kann die Person mit geringem Verlangen mit einem Schauspieler verglichen werden, der ständig Stichworte vermisst . . .« (Rosen & Leiblum, 1988, S. 174, Ü. d. A.).
Um diesen Aspekt geht es bei dem ISS von Clement allerdings nicht. Eine auf den ersten Blick dem ISS ähnliche Technik stellt die bei Weeks & Gambescia (2000) beschriebene Übung dar, in der das Paar in einer Sitzung gemeinsam die Phantasie einer idealen sexuellen Begegnung entwickeln soll. Ein Hauptunterschied zum ISS ist, dass bei dieser gemeinsamen Arbeit etwaige in der Beziehung ex-kommunizierte Differenzen sexueller Interessen vermutlich weiterhin nicht zum Ausdruck gebracht werden.
Nach Clement (2004) muss in einer systemischen Sexualtherapie die Biographie nicht zwingend berücksichtigt werden, seines Erachtens könnte das sogar zu einer Vermeidung der aktuellen Probleme führen. Andererseits räumt er ein, dass alte Verletzungen, offene Rechnungen etc. geklärt werden müssen, bevor Schritte in der Gegenwart möglich sind. Neben der konventionellen oder zirkulären Exploration im Gespräch schlägt er eine Reihe von Techniken vor, die als bis zur nächsten Sitzung schriftlich zu erledigende Aufgaben gestellt werden. So kann die eigene Sexualbiographie in Form einer Graphik erstellt werden.
Zwischenbilanzierende Aufgaben sollen den Paaren dabei helfen zu erkennen, was sie in ihrem sexuellen Leben bewahren und was sie noch entwickeln möchten. Es kann ein Genogramm erstellt werden, das auch die sexuellen Botschaften, Aufträge und Geheimnisse enthält. Die erotische »Bip-Bop-Analyse« soll den sexuellen Entwicklungsstand in verschiedenen Bereichen beschreiben. Bip und Bop sind Kunstworte, wobei Bip in etwa für den jugendlichen, naiven, expansiven Zustand, Bop für den reifen, erfahrenen, ruhenden Zustand steht. Bip und Bop werden im Gespräch erkundet und sollen u. a. aufzeigen, welche Themen biographisch erledigt und welche noch offen sind. Hieraus können sich wichtige therapeutische Hinweise ergeben.
Drei konzeptuelle Phasen
Clement unterscheidet drei konzeptuelle Phasen, die nicht i. S. eines festen zeitlichen Ablaufs zu verstehen sind:
- Der manifeste sexuelle Konflikt als Versuch, die sexuelle Befriedigung im Rahmen der alten Paarstruktur zu verbessern;
- Profilierung der sexuellen Differenz, wobei das ISS eine zentrale Intervention darstellt;
- Beginn einer neuen sexuellen Entwicklung auf der Basis von Differenzierung und sexueller Selbstbestimmung, wodurch sich möglicherweise nicht die Quantität, wohl aber die Qualität und Authentizität der Paarsexualität erhöht.
Erfolgsquote
Die Therapieverläufe seien unterschiedlich, es komme zu Rückfällen, Abbrüchen, Oszillationen zwischen den Phasen oder auch zum Verbleib in der ersten Phase. Das Tempo der Entwicklungen und die Gesamtdauer der Therapien seien ebenfalls sehr unterschiedlich. Clement plädiert dafür, die Möglichkeit des Wechsels in eine neue Partnerschaft als mögliches Therapieergebnis nicht aus den Augen zu verlieren. Hierin distanziert er sich vom Crucible-Konzept von Schnarch (1991), das seines Erachtens zu sehr an der Aufrechterhaltung der bestehenden Beziehung festhalte. Schnarch betrachtet sexuelle Außenkontakte als Ausdruck mangelnder Selbstdifferenzierung der Partner. Clement bezieht sich auf aktuelle Forschungsergebnisse, die zeigen, dass das Modell der lebenslangen, monogamen Beziehung heute einen geringeren Stellenwert als früher hat (Schmidt et al., 2006). Auch die Aufnahme paralleler Außenbeziehungen schließt Clement als Option nicht aus.
Clement empfiehlt, die Therapie in Form von Doppelstunden mit Abständen von ca. vier Wochen durchzuführen; die von ihm beschriebenen Therapien hatten einen Umfang von zwei bis dreißig Sitzungen und dauerten durchschnittlich ein Jahr. Grundsätzlich schlage er den Paaren zunächst nur die Durchführung von drei oder vier Sitzungen vor, mit dem Angebot, die Therapie zu beenden, wenn sich dann noch keine Veränderung gezeigt habe, um die Verantwortung des Paares für die Veränderung zu betonen und dessen Motivation zu erhöhen. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Hamburger Modell, das eine solche »Ausstiegsklausel« nicht vorsieht. Möglicherweise zeigen systemische Sexualtherapien einfach nur deswegen weniger »zähe« Verläufe, weil sie vom Therapeuten abgebrochen werden, bevor es zu derartig problematischen Entwicklungen kommen kann.
Diskussion
Betonung des Wollens und des Begehrens. Der Ansatz von Clement (2001, 2004) hat für die sexualtherapeutische Landschaft in Deutschland wichtige Impulse gebracht und auch eine Diskussion um das von ihm kritisierte Hamburger Modell ausgelöst. Clement spricht sich für einen Paradigmenwechsel in der therapeutischen Grundhaltung aus, bei dem das Wollen und das Begehren der Patienten in den Mittelpunkt der Behandlung gerückt und gestärkt werden. Dabei geht es im Kontrast zu den klassischen (d. h. auf den Ansatz von Masters und Johnson zurückgehenden) Sexualtherapien weniger darum, Angst zu reduzieren, sondern Angst zuzulassen und zu ertragen. Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass es auch heute noch viele Paare gibt, deren Sexualität durch massive Ängste gestört ist; diese Paare profitieren weiterhin von einer klassischen Sexualtherapie, auch wenn dabei nicht mehr als eine Angstreduktion erreicht wird. Auch Schnarch (1991, S. 37 ff.), auf den Clement sich bezieht, geht davon aus, dass eine leichte Angst zwar zu einem »erotischen Prickeln« beitragen kann, intensivere Angst jedoch schnell abträglich für die Sexualität wird.
Abgrenzung zum Hamburger Modell
Clement begehrt gegen eine von ihm wahrgenommene »Übermacht des Nein« bei den klassischen Sexualtherapien auf. Er will die weiblichen Patienten von einer therapeutischen »Overprotection« befreien und die männlichen Patienten sexuell offensiver und mutiger sein lassen. Schmidt (2005) stimmt ihm in dieser Einschätzung zu, auch wenn er ansonsten einige Kritikpunkte von Clement zurückweist. Die Tendenz zur Überbehütung der Frau beim Hamburger Modell ist auch aus unserer Sicht problematisch. Andererseits ist das Recht zum »Nein« eine Errungenschaft, die nicht aufgegeben werden darf. Wenn das »Nein« diskreditiert wird, kann daraus eine ebenso schädliche »Übermacht des Ja« entstehen. Beispielsweise kann daraus der Druck resultieren, sexuelles Verlangen empfinden zu müssen und sich für dessen Abwesenheit rechtfertigen zu müssen. Das zweifelsfreie Recht auf ein »Nein« ist Voraussetzung dafür, diesen Druck zu mindern, und ist somit ein unverzichtbares therapeutisches Agens.
Nach Clement wird beim Hamburger Modell sexuelles Unterlassen (gemeint ist die Nicht-Äußerung einer eigentlich notwendigen Abgrenzung) positiver bewertet werde als sexuelles Tun. Das wird jedoch verhindert, wenn die Ideen von Veto- und Egoismusregel angewendet werden. Beide Regeln erlangen nur in Kombination ihren therapeutischen Sinn. Die Abgrenzung gegenüber einem als unangenehm erlebten Tun des Partners betrifft die Vetoregel, das eigene Tun betrifft die Egoismusregel. Clement unterstellt, dass beim Hamburger Modell eine Patientin, die sich nicht gut abgrenzt, dafür nicht verantwortlich gemacht, sondern von den Therapeuten geschont werde. In unserem Verständnis vom Hamburger Modell ist die Abgrenzung jedoch Teil der Selbstverantwortung, und eine nicht vorgenommene Abgrenzung kann als Verstoß gegen die Vetoregel betrachtet werden.
Auch die Unterscheidung eines »guten« Neins (= bewusste, adäquate Wahrung der eigenen Grenzen) von einem »bösen« Nein (= Vermeidungsstrategie bzw. Manipulation und Kontrolle des Partners) wäre bei der Exploration der Übung leicht möglich, und das »böse« Nein wäre ohne weiteres als Verstoß gegen die Egoismusregel einzuordnen. Ebenso ist es mit der konsequenten Anwendung von Egoismus- und Vetoregel problemlos möglich, passiv-aggressives Verhalten (»Bosheit im Gewande des Nicht-Könnens«) aufzudecken und zu thematisieren. Dasselbe gilt für die von Clement (2004) entworfene Hierarchie verschiedener Intensitäten von Rücksicht, welche die Partner aufeinander nehmen. Er formuliert die maximale Stufe der Rücksichtnahme so: »Ich will es nicht, wenn ich vermute, dass du es nicht willst« (ebd., S. 76).
Auf dieser Basis könne ein Paar eine auf Gegenseitigkeit und Rücksichtnahme basierende freundliche, wenig intensive Alltagssexualität erreichen. Das ist anschaulich und gut nachvollziehbar. Nicht anschließen können wir uns hingegen Clements Argument, dass die maximale Rücksichtnahme zwangsläufiges Ergebnis jeder klassischen Sexualtherapie sei. Unseres Erachtens kann durch die entsprechende Anwendung von Egoismus-und Vetoregel beim Hamburger Modell diese überzogene Rücksichtnahme sogar gut verhindert werden: Die Vetoregel erlaubt jedem Partner, außerhalb des Veto- Moments alles zu tun, was er selbst will; die Egoismusregel verlangt sogar von ihm, sich keine Gedanken über den anderen zu machen. Das ist allerdings unsere eigene Auslegung des Selbstverantwortungsprinzips, und es könnte sein, dass andere Sexualtherapeuten das Hamburger Modell mehr in der von Clement kritisierten Form praktizieren.
Neue Sexualnormen
Irritierend wirkt bei Clement (2004, S. 215 ff.) die Unterscheidung zwischen »schlechtem«, »mittelmäßigem« und »gutem« Sex, die eine klare Bewertung der Sexualität anderer Personen darstellt, obwohl Clement zugleich oft die Notwendigkeit einer neutralen Position des Therapeuten betont, die nicht auf bestimmte Störungskonzepte und Vorstellungen von angemessenem männlichen und weiblichen Verhalten festgelegt ist. Ein therapeutischer Ansatz, dem es nicht genügt, Paaren zu einer vielleicht unspektakulären, aber befriedigenden Sexualität zu verhelfen (was übrigens genau das Ziel der meisten Paare ist), dies als »schlecht« (d. h., spießig, langweilig) einordnet und stattdessen die Forderung nach »gutem«, d. h., wildem, leidenschaftlichem Sex aufstellt, verlässt den klinischen Bereich und nähert sich der Lifestyle-Beratung an (vgl. Briken, 2013). Im Übrigen ist es aus unserer Sicht zum Verständnis der Bedeutung eines Symptoms unumgänglich, sich Gedanken über Störungskonzepte zu machen.
Systemische Perspektive der Paardynamik. Eine besondere Stärke des systemischen Ansatzes ergibt sich aus der Analyse kybernetischer Prozesse in der Paardynamik, insbesondere zeigt sich das bei der Betrachtung sexueller Kollusionen (Clement, 1996). Das sei an dem typischen Beispiel eines Paares erläutert, dessen Sexualität scheinbar unter dem mangelnden sexuellen Verlangen der Frau leidet. Das, was als großer individueller Unterschied im sexuellen Verlangen erscheint, kann Ergebnis eines polarisierenden paardynamischen Interaktionsmusters sein. Obwohl ursprünglich beide Partner ambivalent waren, kann sich durch die sexuelle Kollusion eine Neuverteilung ergeben, bei der ein progressiver (»gesunder«) und ein regressiver (»gestörter«, sexuell lustloser) Pol entstehen. Die progressive Position ist gekennzeichnet durch ein interessiertes, initiatives, drängendes Verhalten, die regressive Position durch Desinteresse, Passivität und Verweigerung. Beide Partner empfinden (oft verdeckten) Ärger auf den anderen: Der regressive Partner fühlt sich bedrängt, der progressive Partner fühlt sich abgelehnt. Dieser kybernetische Selbstverstärkungsmechanismus wurde bereits von Schwartz & Masters (1988) als Spiral Effect beschrieben und stellt eine schöne Illustration des Grundsatzes von Masters & Johnson (1970) dar, nach dem es keinen unbeteiligten Partner bei einem sexuell gestörten Paar gibt.
Jedoch ist auch die Berücksichtigung prägender Erfahrungen aus früheren Lebensphasen bei der Analyse aktueller Beziehungsprobleme wichtig: In einer Beziehung können sowohl die Frau, die z. B. als Kind von ihrem Vater misshandelt wurde, als auch der Mann, der z. B. als Kind von seiner Mutter parentifiziert wurde, von der eben genannten sexuellen Kollusion profitieren, egal, wer dabei die progressive oder die regressive Position einnimmt, weil damit auf jeden Fall die Angst vor einer Wiederholung der traumatisierenden Erfahrung aus der Kindheit (Kontrollverlust, Missbrauch) kompensiert wird. Fundamentale Ängste dieser Art dürften nicht so einfach durch Veränderung der Kommunikation des Paares aufzulösen sein. Hier erscheint die Möglichkeit, in den Sensate-Focus-Übungen selbstverantwortlich neue, korrigierende Erfahrungen zu machen, besser geeignet. Eine sorgfältige Erhebung der Biographie ist unseres Erachtens in jedem Fall notwendig, um Kenntnis über etwaige biographische Prägungen der oben genannten Art zu haben.
Fehlende empirische Prüfung
Die Betrachtung des Nicht-wollens bzw. Nicht-so-wollens als eigentlichem Hintergrund eines sexuellen Symptoms scheint uns insbesondere beim mangelnden sexuellen Verlangen wichtig zu sein (vgl. Eck, 2014). Angesichts der Hinweise darauf, dass das Hamburger Modell für die Behandlung dieser Störung nicht sonderlich geeignet ist (Maß, 2014, 2016; Maß et al., 2014; Maß & Briken, 2016), sollte ernsthaft geprüft werden, inwieweit die bereits von Schmidt (2005) geforderte »systemische Renovierung« des Hamburger Modells zu besseren Erfolgen führen kann. Es ist allerdings unklar, wie diese Renovierung konkret aussehen könnte. Leider gibt auch für die Systemische Sexualtherapie zwar zahlreiche anschauliche Fallbeispiele (z. B. Clement, 2004, S. 174 ff.; von Tiedemann, 2004), aber keine systematischen Evaluationsstudien.
Beispielsweise wäre es wichtig, zu wissen, bei wie vielen Paaren die von Clement beschriebene »Ausstiegsklausel« tatsächlich zur Anwendung kommt, es werden hierzu keine Angaben gemacht. In der Outcome-Forschung werden solche Verläufe üblicherweise als Misserfolge betrachtet (Intention-to-treat). Inwieweit erreichen die behandelten Paare tatsächlich das Hauptziel der Behandlung, also eine verstärkte Differenzierung des Selbst? Clement geht nicht auf die Möglichkeiten ein, Selbstdifferenzierung psychometrisch zu erfassen, dabei liegt ein geeignetes Verfahren vor (Skowron & Friedlander, 1998; Skowron & Schmitt, 2003).
Können sexuell gestörte Paare, deren Selbst hinreichend differenziert ist, überhaupt von einer Systemischen Sexualtherapie profitieren?
Unklar ist, bei wie vielen Paaren, die sexualtherapeutische Hilfe suchen, tatsächlich bei einem der Partner oder bei beiden eine zu geringe Selbstdifferenzierung vorliegt. Was bedeutet es für die Therapie, wenn nur bei einem der beiden ein Differenzierungs-Defizit vorliegt? Zu prüfen wäre auch die Hypothese, ob eine erhöhte Differenzierung tatsächlich mit einer Symptomreduktion bzw. einer Verbesserung der Sexualität einhergeht.